|
Frauenkleidung
|
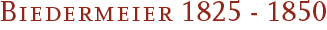 Der Wohlstand wirkte sich auch auf die Kleidung der Frau aus, sie repräsentierte den Reichtum des Mannes. Durch die weniger ansprechende Silhouette des Empire wollten die Frauen nun wieder ihre Taille hervorheben. Als Schönheitsideal des Biedermeier galten zarte, zerblich wirkende Frauen mit schmalen Schultern und schmaler Taille, welches durch die Kleidung widergespiegelt wurde.
Die Kleidung wurde im Laufe der Zeit immer unpraktischer und die ausladenden und aufwendigen Formen zwangen die Frau zur Untätigkeit. Charakteristisches Merkmal der Kleidung dieser Zeit war die Krinoline, anfangs noch als steife Unterfütterung des Damenrockes, später als Reifrock mit eingearbeiteten Stahlreifen, sowie die breiten Keulenärmeln.
Die Form und Ausstattung der Kleidung änderte sich ständig, da die Oberschicht sich von den unteren Schichten abgrenzen wollte. Für die ärmeren Frauen der Unterschicht begann man Schnittmuster zu verkaufen, so dass diese sich ihre Garderobe selbst nähen konnten. Zur Zeit der Befreiungskriege wurden in Deutschland altdeutsche Trachten modern.
Der Wohlstand wirkte sich auch auf die Kleidung der Frau aus, sie repräsentierte den Reichtum des Mannes. Durch die weniger ansprechende Silhouette des Empire wollten die Frauen nun wieder ihre Taille hervorheben. Als Schönheitsideal des Biedermeier galten zarte, zerblich wirkende Frauen mit schmalen Schultern und schmaler Taille, welches durch die Kleidung widergespiegelt wurde.
Die Kleidung wurde im Laufe der Zeit immer unpraktischer und die ausladenden und aufwendigen Formen zwangen die Frau zur Untätigkeit. Charakteristisches Merkmal der Kleidung dieser Zeit war die Krinoline, anfangs noch als steife Unterfütterung des Damenrockes, später als Reifrock mit eingearbeiteten Stahlreifen, sowie die breiten Keulenärmeln.
Die Form und Ausstattung der Kleidung änderte sich ständig, da die Oberschicht sich von den unteren Schichten abgrenzen wollte. Für die ärmeren Frauen der Unterschicht begann man Schnittmuster zu verkaufen, so dass diese sich ihre Garderobe selbst nähen konnten. Zur Zeit der Befreiungskriege wurden in Deutschland altdeutsche Trachten modern.
Jacken und Mäntel
Der aus leichten Stoffen, wie Tüll, Batist oder Musseline gefertigte „Canezou“, ein Rundspenzer entwickelte sich um 1825 zu einem großen Schulterkragen. Seine Kanten wurden mit Rüschen oder Spitzen besetzt. Die verlängerten vorderen Spitzen wurden überkreuzt und in der Taille durch eine umgebundene Schleife gehalten.
Oberteile
Die Taillenlinie rutschte zu Beginn der 20er Jahre wieder ein kleines Stück nach unten, blieb aber immer noch weit über ihrem natürlichem Verlauf. Die Ärmel waren an der Schulter leicht gepufft und mit einem Band zusammengehalten.
Im Laufe des Jahrzehnts wuchs der Umfang der Ärmel soweit, dass sie bald die Bezeichnung "Hammelkeule", "Schinkenärmel" und "Elefantenärmel" erhielten. Um die Form der riesigen Keulenärmel zu erhalten, mussten sie mit Polstern und Rohrgestellen gestützt werden. Ihren Höhepunkt erreichten diese ausladenden Ärmel um 1830. Die breiten Ärmel und der weite Rock ließen die Taille und die Schultern schmal erscheinen.
Röcke
Um 1820 waren die Röcke bodenlang und schmal geschnitten . Ab 1830 wurde der Rock wieder weiter und verkürzte sich, so dass die zierlichen Schuhe sichtbar wurden.
Der Umfang der "Röcke" wurde langsam weiter, wobei der Rock jedoch immer noch den Fuß frei ließ. Erst ab 1836 lag der Rock wieder auf dem Boden auf. Er wurde mit Volants, Schleifen, Puffen, Plissees und Falbeln reich verziert.
Kleider/Kostüme
Die "Kleider" besaßen anfangs eine kurze Taille, die unmittelbar unter der Brust verlief. Der schmal, leicht ausgestellte Rock des Kleides endete über den Knöcheln. Die anfangs noch schmalen Ärmel wurden um 1818 mit Schulterpuffen versehen. Sie lagen eng an und reichten bis zu den Fingern.
Während die Tageskleider hochgeschlossen waren, ließ der Ausschnitt der Abendkleider die Schultern frei.
Die erhöhte Taille wurde durch Gürtel oder zu Schleifen gebundenen langen Bändern betont.
Der weite Ausschnitt der Kleider wurde mit der sogenannten "Berthe" eingefasst, ein großer umgelegter Kragen aus Spitze oder Stoff. Bei der Verwendung von Stoff, wurde dieser oftmals in einigen Reihen von waagerechten falten gelegt. Die Mitte des Ausschnittes schmückte eine Blume oder eine Brosche.
Unterkleidung
Der Körper wurde nun wieder eingeschnürt und die Damenwelt holte nach über 20 Jahren das Korsett wieder hervor.
Der Unterrock wurde allmählich steifer, um das Kleid abzustützen. Bereits Anfang der 30er Jahre trugen die Damen mehrere Unterröcke übereinander.
Der leicht ausgestellte Unterrock wurde bald an ein kleines Leibchen angenäht, so dass ein Unterkleid entstand. Unterhalb des Knies bis knapp zum Saum wurden Reihen mit eingenähten Schnüren zur Versteifung angebracht, diese Unterröcke kann bereits als Vorläufer der Krinoline betrachten.
Unter den Kleidern trugen die Frauen die sogenannten "Calecons", knöchellange, weiße Unterhosen, die gelegentlich unter dem Kleid hervorschauen konnten. Sie waren gerade geschnitten und am Hosensaum mit einer kleinen Rüschenborte verziert. Am breiten Bund wurden sie in kleinen Fältchen angesetzt.
Unter den Kleidern trugen die Damen eine "Chemise" aus Leinen mit einem tief ausgeschnittenen, viereckigem Ausschnitt und kurzen Ärmeln. Der Auschnitt wurde von einer kleinen Rüsche eingefasst.
Unter weitausgeschnitten Kleidern wurde oftmals eine "Chemisette", ein Bluseneinsatz aus zarten Batist, Tüll oder Musselin, getragen. Kleine Fältchen und zarte Stickereien schmückten die Chemisette.
Das Schönheitsideal der "Wespentaille" wurde durch ein enggeschnürtes "Korsett" erreicht. Die Ausschnittkante der Korsetts verlief knapp über der höchsten Stelle der Brust. Ösen aus Stahl verstärkten die Löcher für die rückwärtige Schnürung. Dreieckige Einsätze an den Brüsten und den Hüften formten die Silhouette. Das Korsett wurde aus fester Baumwolle gefertigt und mit Musselin oder Satin bezogen. Beliebt waren helle Korsetts in weiß oder creme.
Das meist trägerlose, mit Spitzen und Schleifen verzierte Korsett reichte bis zur Hüfte und konnte in der Taille bis auf 40 cm eingeschnürt werden.
Für schwangere Frauen gab es sogenannte "Umstandskorsetts", die im Brustbereich, am Bauch und an den Seiten elastisch gearbeitet waren. Der verstärkte vordere Bereich, drängte den Bauch der Schwangeren allerdings eher zurück, als dass er ihm Halt gab.
Die zunehmende Industrialisierung brachte bald neue Korsettschließen hervor. So entwickelten sich aus dem Blankscheit 2 breite Stahlstäbe, eine mit Ösen und die andere mit Knöpfen. Diese neue Erfindung ermöglichte nun ein leichteres an- und Ausziehen des Korsetts.
Während im 18. Jahrhundert des Nähen von Korsetts hauptsächlich von Männern ausgeführt wurde fertigten nun die "Couturiéres en Corsets", selbsttändige Korsettnäherinnen, die Korsetts. In Paris gab es bereits erste Korsettfirmen, die auch wohlhabende deutsche Frauen belieferten.
Stoffe und Farben
Leichte Stoffe wie Batist, Musselin und Seide waren sehr beliebt. Aber auch Taft, Atlas und Merino-Wolle kamen zum Einsatz. Neben zart geblümten wurden gestreifte und karierte Stoffe modern. Helle und zarte Farben waren sehr beliebt. Gewöhnliche Kleider waren aus bedruckter Baumwolle, Krepp, Tüll, Musselin und Gaze, im Winter aus Wolle, Seidenstoffen, Moiré, Taft und Rips gefertigt.
Frisuren und Kopfbedeckungen
Nach der leichten, natürlichen Frisurform des Empire, entwickelte sich die Haarmode allmählich zu einer steiferen Form. Die langen Haare werden zu kunstvollen Frisurgebilden aufgesteckt, bei denen das Gesicht von Locken umrahmt ist.
Zwischen 1820 und 1830 wurde das Haar gescheitelt und glatt an den Kopf gelegt. Am Hinterkopf formte man einen Knoten aus geflochtenen Haarsträhnen.
Die festliche Abendfrisur wurde mit Blüten, Federn und Bändern geschmückt.
Mit zunehmender, breiter Silhouette der Kleidung wurden auch die Frisuren raffinierter und aufwendiger.
Um 1830 trugen die Damen ihr Haar weiterhin straff zurückgekämmt, jedoch wurde der hintere Knoten jetzt höher und auffälliger gestaltet, in dem man ihn zu einer Art Schleife formte, die mit geflochtenen Strähnen zusammengehalten wurde. Die Stirn blieb frei, während die Seiten des Gesichts von großen Lockentuffs eingerahmt wurden, die mit den breiten Keulenärmeln der Kleider harmonieren.
Bereits ab 1835 wurden die Frisuren jedoch wieder kleiner. Das nach wie vor gescheitelt Haar wurde zu einem kleinen Knoten am Hinterkopf zusammengesteckt, an den Seiten ließ man schulterlange Korkenzieherlocken herunterhängen. Neben den Korkenzieherlocken wurden die sogenannten "Affenschaukeln" beliebt, seitliche, geflochtene Haarsträhnen, die zu einer Schlaufe aufgebunden wurden.
Neben dem einfachen Scheitel kamen gegen Ende der 30er Jahre T-Scheitel auf, bei denen das Haar am Oberkopf zu einem Dreieck abgeteilt wurde. Das Haar der mittleren Partie wurde nach hinten und die seitlichen Haarpartien glatt nach unten gekämmt.
Haaröl diente dem haltbar machen der aufwendigen Frisuren.
Die typische Kopfbedeckung dieser Zeit war die Schute, eine haubenartige Kopfbedeckung, deren weit hervorragende Krempe das Gesicht umrahmte.
Schuhwerk
Die absatzlosen Schuhe und kleine geschnürte Stiefel blieben erhalten.
 

|
|